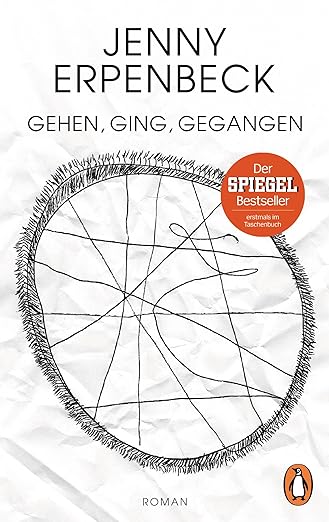Jenny Erpenbeck, Gehen, Ging, Gegangen
Ich hatte mich, wieder einmal gewundert. Kaum hatte ich gelesen, dass man in den USA von einer gewissen Jenny Erpenbeck, einer Deutschen, als der vielleicht nächsten Nobelpreisträgerin für Literatur lesen konnte, flammte die Meldung auf, dass Besagte den diesjährigen Booker Prize in London bereits bekommen hatte. Zusammen mit Michael Hoffman, dem Übersetzer ins Englische. Der Roman, für den sie prämiert wurde, ist der mit dem Titel „Kairos“. Da hatte ich mir schon ein anderes Werk von Erpenbeck gekauft und zu lesen begonnen. Dabei handelt es sich um den Roman „Gehen, Ging, Gegangen.“ Und der hatte mich nach wenigen Seiten bereits in seinen Bann gezogen.
Worum es geht? Um die Geschichte der Migration in unseren Tagen. Um Menschen, die Not und Mord und entsetzlicher Armut entflohen sind. Die irgendwann, nach wahrhaftigen Irrfahrten mit vielen Toten, hier aufschlagen. In den Metropolen von reichen Staaten mit einem bürokratisierten Gemeinwesen. Und es geht um Menschen von hier, die auch Reisen hinter sich haben. Weniger geographisch, aber geschichtlich und ebenso kulturell. Zum Beispiel von der DDR zur vergrößerten BRD. Die vieles haben genießen können, aber bei den immensen Veränderungen vielleicht auch ihre eigene, vorherige Identität vergessen haben.
In einer klugen Inszenierung treffen diese Welten in dem Roman aufeinander. Die einen kämpfen um Verständnis. Nicht nur für sich, sondern auch getragen von dem Willen, die Welt verstehen zu wollen, in die sie gekommen sind. Und da bietet sich ein Übersetzer an, der, cum grano salis, eine ähnliche Reise bereits hinter sich hat. Sein Vorteil besteht darin, dass er den Neuankömmlingen, für die er sich interessiert, Fragen stellt, die einfach sind, die auf der Hand liegen, und die von denen, die sich als die Statthalter dieser Welt, für die Berlin eine wunderbare Metapher darstellt, begreifen, die sich aber so schwer tun, sie zu beantworten. Warum? Weil sie den Perspektivenwechsel nicht gewohnt sind. Ihr Ausguck auf die Welt scheint betoniert und unberührt von den Stößen zu sein, von denen das Mobile des Globus in Bewegung gehalten wird.
Mit einem scheinbaren Alltagsproblem, das durchaus strukturell ist und das so viele Gemüter erhitzt, gelingt es Jenny Erpenbeck, ohne moralischen Zeigefinger, ohne Überheblichkeit, sondern anhand eines sich immer weiter entwickelnden Fragebogens, die Statik der Betrachtung freizulegen und als ein Problem darzustellen, dessen Lösung aussteht. Alle Beteiligten ihrer Geschichte geben ihr Bestes, um einander zu verstehen, um einender zu helfen oder um sich oder das mit der Präsenz der Ungebetenen auftauchende Problem zu ignorieren. Der Weg, den sie beschreiten, ist gepflastert mit vielen Steinen tiefer Menschlichkeit und feiner Gesinnung, aber auch mit abgründiger Enttäuschung und Verzweiflung.
„Gehen, Ging, Gegangen“ ist ein Roman, der die Komplexität unserer Welt mit einer einfachen Geschichte erfasst, der die deutsche Sprache in ihrer subtilen Dimension zur Geltung bringt und der anhand der so schlauen wie einfachen Fragen, die er aufwirft, mehr ist als nur Romanlektüre. Da ist eine große Schriftstellerin, deren Qualität im eigenen Land noch nicht so richtig zur Würdigung gelangte. Das nächste Buch von ihr liegt bereits auf dem Tisch.