Ethnologen wie Mythenforscher sind sich in einem Punkt zumeist einig: Der Zivilisationsgrad einer Gesellschaft wird in starkem Maße neben den vordergründigen Techniken von der Art und Weise des Umgangs mit den festen Größen der natürlichen Existenz bestimmt. Gesellschaften, die rituell gesicherte und somit vernünftige Erklärungen für die Geburt wie den Tod aufweisen, produzieren auch auf anderen, existenziell bedeutenden Feldern lebenswichtige Sinnzusammenhänge. Von den Fruchtbarkeitsritualen der Hopi bis zu den Todesmythen Roms sprechen bis heute Weisheiten zu uns, die etwas aussagen über die Definition des Menschen in seinem sozialen Umfeld.
Besonders der Tod ist in nahezu allen Zivilisationen ein hermeneutisches Prinzip für das Leben. Oder, um es anders auszudrücken, in dem die post-existenziellen Formen des tödlichen Daseins aufgemalt werden, wird verdeutlicht, welche Zinssysteme für das diesseitige, materielle Leben Geltung haben. Wer im Diesseits tüchtig ist, dem wird es das Jenseits vergelten und wer im Diesseits das schlechte Handeln bevorzugt, der wird im Jenseits Böses zu erwarten haben. Selbst das mystische Leben in den vor-aufgeklärten Gesellschaften beschert uns heute eine Erkenntnis, über die wir stets erhaben gewesen schienen: Dass nämlich selbst der Mensch des Mittelalters aufgeklärter war als der gemeine Zeitgenosse der Moderne. Das mittelalterliche und antike Wissen um die Vergänglichkeit der Welt und die Gewissheit, dass das irdische Dasein nicht automatisch Glück und Erfüllung beinhalte, macht die Zeitzeugen jener Epochen zu kritischeren Wesen als jene Träumer unserer Tage, die hordenweise der Mystifikation erliegen, Glück und Erfüllung seien ein verbrieftes Bürgerrecht.
Wer so der Ideologie wie der Idealisierung erliegt, dem fällt es auch nicht schwer, weitere Axiome der menschlichen Existenz auszublenden. Der glaubt dann auch tatsächlich, dass das ewig Juvenile käuflich und der Tod vermeidbar ist. Der Sinn des Todes, unser Dasein inmitten der Gesellschaft mit einem Bezugsrahmen auszustatten, ist verloren gegangen, die Definition des Seins als etwas zu Leistendem, noch vor wenigen Jahrzehnten ein Leitmotiv der revolutionär definierten Existenzialisten, einfach ausgeblendet und zu den Akten gelegt.
Wäre da nicht noch etwas anderes, das die mystifizierte Gesellschaft nicht dennoch dazu triebe, sich mit dem Tod zu beschäftigen! Wie die Masern und Windpocken nämlich zur Kindheit zählen, so ist die Fokussierung auf den Tod ein Symptom für die gesellschaftliche Dekadenz. Das Morbide, zumeist auch mit dem Charakteristikum des Charme benannt, ist es, was momentan dazu antreibt, sich mit dem Tod so kampagnenhaft zu beschäftigen. Bei allen Beiträgen, die über die Kanäle der öffentlich-rechtlichen Sender ausgestrahlt werden, geht es exklusiv um das Hinsinken in das Nichts. Bezüge, die es erlaubten, aus der Gewissheit der Vergänglichkeit ein Zinssystem auf die Diesseitigkeit zu entwickeln, werden vergeblich gesucht.
Ob die Römer den Dahingegangenen Goldmünzen als Lohn für den Fährmann auf die Augen legten, ob die der Antike verhafteten Europäer dem Fahrer von Tantalus Wagen ein Mahl anboten, ob die Oberbayern ein schöne Leich feierten oder die Marching Bands von New Orleans im binären Groove den Friedhof wieder verließen, sie alle wussten, was anscheinend in unseren Tagen dem Programm der psychopathologischen Verdrängung zum Opfer gefallen ist: Gestorben wird immer. Und jeder stirbt für sich allein.

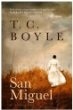
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.