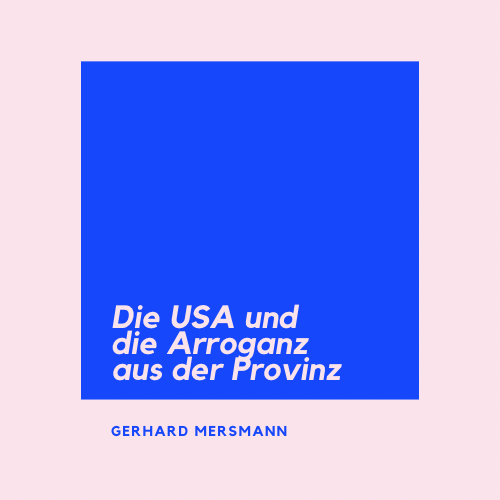Vor einigen Tagen las ich einen Artikel einer Ukrainerin, den sie damit begann, die allgegenwärtigen ukrainischen Farben im deutschen Alltagsleben nicht mehr ertragen zu können. Sie erklärte es auch. Die Lage in ihrem Land, unter der sie selbst auch familiär leidet, ist komplexer als das in Deutschland massenhaft publizierte Bild vermuten lässt. Sie wies auf vieles hin, was bei der Berichterstattung in Deutschland keinen Eingang findet. Die Fragwürdigkeit der Regierung Selensky, deren brutales Vorgehen gegen die russische Bevölkerung im Donbas, die momentane Hochrüstung rechtsradikaler Verbände, die Herausbildung von Berufssoldaten, die sich in keinem zivilen Leben mehr werden einfügen können, die unbegrenzte Verfügbarkeit von Waffen, die schon vor der russischen Aggression bedenkliche Beeinflussbarkeit der Justiz, Methoden der Folter auf ukrainischer Seite – das alles seien Faktoren, die zu berücksichtigen seien, wenn es um eine wie auch immer geartete Zukunft des Landes ginge. Den Überfall Russlands beschönigte sie indessen nicht, sie machte sich nur, quasi als Gegenzeichnung zu einem hier vermittelten Bild, bei dem zunehmend auch von der Möglichkeit eines „Sieges“ gesprochen werde, was sie für eine gefährliche Wahnvorstellung hielt, Gedanken über eine mögliche Zukunft. Die, so schloss sie, sei mit der im Westen produzierten Darstellung der Verhältnisse ausgeschlossen.
Es ist nicht nur das Thema Ukraine, das mich dabei inspirierte, sondern die Fähigkeit der Deutschen, in kurzer Zeit und auf große Distanz gleich im Bilde darüber zu sein, was in anderen Ländern und Kulturen geschieht. Das brachte einmal ein sein ganzes Leben für die Bundesrepublik in allen möglichen Ländern unterwegs gewesener technischer Berater auf den Punkt, den ich fragte, wie nach all den Jahren, die er in fremden Ländern gelebt habe, sein Verhältnis zu Deutschland sei. Es sei, so antwortete er ohne zu zögern, ein schönes, wohl organisiertes Land, in dem sich gut leben ließe. Nur eines täte er, wenn er hier sei, nicht mehr: er ginge auf keine Partys oder Feste mehr. Denn dort, wenn er gefragt würde, wo er gerade lebe und arbeite, fänden sich immer gleich einige, die ihm nach einem zweiwöchigen Urlaub in dem betreffenden Land alles erklären könnten und ihm noch Tipps gäben, wie er am besten seinen Job mache. Das sei für ihn kaum zu ertragen.
Ich selbst kenne dieses Phänomen auch und wir alle haben es in den letzten beiden großen Krisen erlebt. Bei Corona mutierte das Volk in Sekundenschnelle zu medizinischem Fachpersonal und seit dem Ukraine-Krieg sind alle versierte Politologen mit dem Schwerpunkt Osteuropa. Positiv betrachtet, handelt es sich dabei um ein großes Interesse zu den Fragen der Zeit. Was nachdenklich stimmt, ist diese unheimliche Fähigkeit, mit geringem Aufwand eine Expertise zu erreichen, für die andere Menschen ein ganzes Leben brauchen.
Aber vielleicht verbirgt sich dahinter etwas ganz anderes. Wer sich schnell auf etwas fokussiert, das außerhalb der eigenen Problemlagen stattfindet, kann besagte kritische Felder wunderbar ausblenden. Psychisch kann auf dem Alibi-Feld alles ausgetragen werden, was emotional herausmuss, und trotzdem bleibt die Arbeit an den eigenen Defiziten erspart. In der Psychologie korrespondieren mit diesen Verhaltensweisen die Begriffe der Verdrängung und der Übersprungshandlung.
Das Fazit der Betrachtung ist der wenig emphatische Schluss, dass es sich bei der Schlaumeierei gegenüber fremden Angelegenheiten um den Versuch handelt, die eigene Unzulänglichkeit auszublenden. Glücklicherweise gibt es dazu eine Formulierung, die gute Freunde benutzen, wenn sich auf ein solches Phänomen stoßen. Sie lautet: Wir müssen reden!