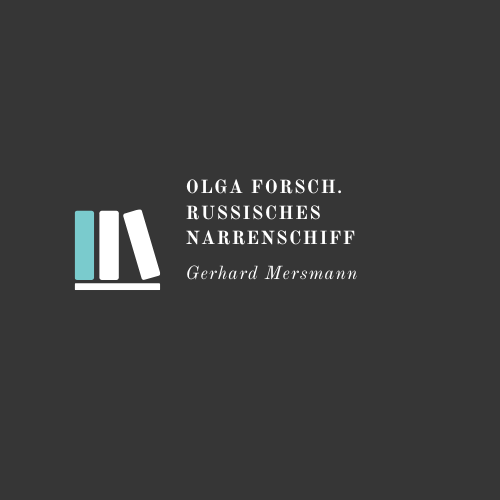Das Phänomen, mit dem wir uns momentan alle auseinandersetzen müssen, besteht in der Ungewissheit und der aus dieser abgeleiteten Tristesse. Warum das Nicht-Wissen zumeist einen Weltschmerz hervorbringt, liegt wohl im Wesen des Menschen begründet. Zumindest im Wesen dessen, den wir in den gefühlt final-zivilisatorischen Gesellschaften des Westens antreffen. Kein Veränderungsprozess kann dort beginnen, ohne dass ein immenser Aufwand betrieben und immer wieder kommuniziert wird, dass die bevorstehende Veränderung nichts schlechtes ist, dass sie sogar Vorteile bringen wird und dass niemand bei dem Prozess zu Schaden kommen wird. Die Skepsis bleibt immer und es ist ein aufregendes wie aufzehrendes Geschäft, den Wandel zu gestalten.
Warum das so ist, lässt sich nur vermuten. Dass es in einer Gesellschaft grassiert, die seit der Renaissance für eine ungeheure Dynamik steht, ist hinsichtlich des Kollektivbewusstseins etwas absurd, es sei denn, man betrachtet es durch die Brille der sozialen Kosten, die Umbrüche verursachen und die Adresse derer, die in der Regel den Preis bezahlen. Da sind es immer die gesellschaftlich Schwächsten gewesen, d.h. diejenigen, die selbst nicht in der Lage waren, zu gestalten, selbst wenn sie es gekonnt hätten oder diejenigen, die sich schlicht im Sinne Darwins nicht anpassen konnten. Game over! Rien ne va plus! Ob das zu der heutigen Massenskepsis geführt hat?
Aber, auch das wissen wir, jammern nützt nichts. Das schrieb schon der längst aus der Mode gekommene Pädagoge des revolutionären Russland, Anton Semjonowitsch Makarenko, über den Eingang einer seiner Musteranstalten für die Eingliederung der Besprisornis, obdachloser, vagabundierender Kinder und Jugendliche, die in den Zeiten des zusammenbrechenden Zarismus ein Massenphänomen waren und die heute unter der Chiffre UMAs ihre modernen Vorboten nach Europa schickt. Nicht jammern! Das stand da, und das war der Ausgangspunkt einer harten Pädagogik, die darauf setzte, Menschen heranzubilden, die sich mit eiserner Disziplin selbst aus dem Morast ziehen konnten und die eine Aufgabe darin sahen, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu werden. Der Schriftsteller Maxim Gorki gehörte als Kind dieser Gruppe an und er beschreibt in seinen autobiographischen Erzählungen die Erfahrungen, die er dort machte, und zwar als seine Bildungsetappen.
Das Jammern, seinerseits Massenphänomen unserer Tage, obwohl im Vergleich mit vielen anderen Ländern die Lebensbedingungen als sehr gesichert gelten, stünde einem Teil der Gesellschaft, aber nicht der großen Mehrheit, zu. Insofern handelt es sich um eine Dekadenzerscheinung, die nur den Sinn hat, von der Aktivität konstruktiven Gestaltens abzuhalten und sich an den Szenarien eines möglichen Untergangs zu laben. So lässt sich in der grausamen Dimension der Logik denen, die sich dem Jammern verschrieben haben, eine schlechte Prognose für die Zukunft ausstellen. Das sei all denen ins Journal geschrieben, die eigentlich das Zeug dazu hätten, sich über die Zukunft und ihre Gestaltung Gedanken zu machen.
Und natürlich drängt sich da auch ein Zitat aus den Geschichten aus dem Wienerwald des so unglaublich ums Leben gekommenen Ödon von Horváth auf. Der war bekanntlich auf dramatische Weise den Nazis durch die Maschen gegangen und hatte es bis ins damals noch freie Paris geschafft. Dort flanierte er erleichtert auf den Champs Élysée und wurde bei einem aufkommenden Sturm – von einem herabfallenden Ast erschlagen.
Ach ja, das Zitat: Ich gehe, und weiß nicht, wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin!