2. November 2016
Ehrlich gesagt, mir war etwas mulmig. Mein Terminkalender war voll, ich hatte genug zu tun. Zuhause. Aber wie das so ist, während einer etwas ruhigeren Phase hatte ich mich bereit erklärt, in Kiew ein Seminar abzuhalten. Es handelte sich um eine Kooperation einer deutschen Hochschule mit dem Dachverband der ukrainischen Verwaltungshochschulen, in der die Handlungsfähigkeit ukrainischer kommunaler Verwaltungsfunktionäre mit ihren sehr konkreten, praktischen Herausforderungen das Thema war. Das, was ich vielleicht am besten mit dem Begriff des ukrainischen Politikums bezeichnen möchte, hatte in Deutschland die Gemüter sehr erhitzt. Es ging und geht um den EU-Beitritt des Landes mit dem Junktim der NATO-Osterweiterung. Wie bekannt, führte dies zu einer schweren Verwerfung mit Russland, die in militärischen Operationen auf der Krim wie im Donbass kulminierte und deren Ausgang noch nicht abzusehen ist. Ich hatte mich sehr früh auf eine Verurteilung der Westpolitik festgelegt, weil ich den Kalten Krieg noch kannte und die Voraussetzungen für eine Wiedervereinigung Deutschlands noch sehr präsent sind. Da ist vieles in Vergessenheit geraten, was der Diplomatie sehr geschadet hat.
Nichtsdestotrotz reizte mich das Angebot. Einerseits ist es immer spannend zu sehen, wie Menschen in Verantwortung mit krisenhaften Veränderungsprozessen umgehen und andererseits sieht man vor Ort immer besser, worum es eigentlich geht, fernab der politisch motivierten Kommunikation in der offiziellen Berichterstattung. Kurz, ich hatte meinen Flug gebucht und versuchte trotz des zeitlichen Engpasses so vorurteilsfrei wie möglich mein Flugzeug zu besteigen und die Reise als eine Chance auf neue Erkenntnisse zu begreifen.
Es war ein wunderschöner Spätsommerabend, als das Flugzeug zur Landung ansetzte. Kiew erschien in einem goldenen Abendlicht. Was gleich auffiel, war, dass die Stadt eingebettet und durchzogen ist von Wald und Wasser. Wie Inseln der Stadt Utopia tauchten in dem vielen Grün und Blau immer wieder weiße urbane Kleckse auf, in denen schlanke Hochhäuser standen. Alles machte einen extrem friedlichen Eindruck, der mit den Eindrücken aus den Medien nichts zu tun hatte. Aber, es war hoch oben aus der Luft und ich war gespannt, wie sich das Bild weiter entfalten sollte.
Als ich den Zoll durchschritten hatte und die Halle betrat, sah ich viele Menschen mit Schildern, auf denen die Namen derer standen, die erwartet wurden. Erst beim dritten Hinschauen konnte ich in dem Schilderwald meinen Namen erkennen. Mir nickte ein freundlicher Mann entgegen, der mir gleich meinen Koffer aus der Hand nahm und mir bedeutete, ihm zu folgen. Das ging alles sehr schnell, ich sprach ihn zunächst auf Englisch und dann auf Deutsch an, was beides nicht fruchtete. Schon standen wir vor einer großen, schwarzen Limousine mit verdunkelten Scheiben. Der Koffer wurde verstaut und mir die Tür für die Rückbank geöffnet. Hinter dem Steuer saß ein Hüne von einem Mann, der mich nicht beachtete und wartete, bis mein neuer Begleiter neben ihm Platz genommen hatte. Beide sprachen miteinander, Russisch, wie ich vermutete, aber nicht mit mir. Also hatte ich zu vertrauen und zu sehen, was kam.
Ich wusste, dass der Kiewer Flughafen Borispol außerhalb der Stadt lag und die Fahrt etwas dauern würde, ohne genau zu wissen, wohin die Reise eigentlich ging. Gleich waren wir auf einer Stadtautobahn, auf der deutlich wurde, dass wir uns in einer Art Rushhour befanden. Immer wieder kleinere Staus. Der Fahrer verließ die Autobahn das eine um das andere mal, um durch Trabantenstädte zu fahren, in denen große Wohnhäuser standen, ab und zu ein Supermarkt zu sehen war, aber sonst weniges, was das urbane Leben ausmacht. Ab und zu eine ältere Frau, die Gurken und Tomaten an der Straße verkaufte, ansonsten Blechlawinen und Bushaltestellen. Dann durchfuhren wir Birkenwälder, um wieder auf einer Autobahn zu landen, von der es wieder durch Trabantenstädte ging. Die beiden Herren bekamen ab und zu Anrufe auf ihrem Handphone, brabbelten etwas Russisches oder Ukrainisches und schwiegen wieder.
Dann, nach ungefähr einer Stunde, erreichten wir die Staus in der Stadt, die wohl das eigentliche Kiew sein musste. Dort boten sich andere Bilder. Monumente und Gebäude aus anderen, glorreicheren Zeiten, breite Alleen, verschwenderische Boulevards. Die Menschen wirkten trotz der allgemein vorherrschenden Geschäftigkeit ruhig und gelassen. Nun sah ich Arme des Dnjepr, der durch die Stadt fließt. An seinen Ufern lagen die Menschen, manche badeten, alles wirkte entspannt. Und wieder folgten Staus, und wieder ging es ein Stück weiter. Städtische Häuser mit grün gestrichenen Holzfassaden und Erkern, Kioske, an denen Kaffee, Snacks und Bier verkauft wurde, Bänke, auf die Passanten saßen und sich unterhielten.
Endlich, nach ungefähr 1 1/2 Stunden hatten wir anscheinend das Ziel erreicht. Wir standen vor einem Hochhaus, das mir mein Begleiter als Hotel vorstellte. Er bedeutete mir, dort einzuchecken und ihn danach wieder in der Halle zu treffen, weil ich noch einen Termin hätte. Es stellte sich heraus, dass es sich wohl um ein Wohnheim der Studenten handelte, die in der Verwaltungshochschule studierten. Das Etablissement war ziemlich heruntergekommen und korrespondierte in keiner Weise mit dem Publikum, zumindest zum Teil. Mir fiel gleich auf, dass es die jungen Männer eher sehr leger nahmen, denn sie liefen in verknuddelten T-Shirts, Trainingshosen und Badeschlappen herum, während die Frauen sehr modisch und schick gekleidet waren. Nachdem mir eine übergewichtige, schlecht gelaunte Concièrge meinen Schlüssel für ein Apartment im 11. Stock gereicht hatte, begab ich mich zum Aufzug. Der wiederum wirkte wie die krächzende Version einer stillgelegten Grube und war wohl nur für Zeitgenossen mit einem ungebrochenen Gottvertrauen geeignet. Als ich mein Apartment aufschloss, wurde mir endgültig klar, dass ich in einem Land angekommen war, das noch lange nicht aus dem Gröbsten heraus ist.
Ich betrat einen überhitzten, stickigen Raum, alles wirkte verbraucht und provisorisch. Ich stellte meinen Koffer ab und beschloss, so schnell wie möglich zu meinem Termin zu kommen. Auf dem Weg zum Aufzug überlegte ich, wann ich zuletzt in einem derartige Hotel übernachtet hatte und ich wurde gleich fündig. Es war lange her, irgendwann in den achtziger Jahren, da hatte ich in Malaga in einem Hotel genächtigt, in dem außer Fremdenlegionäre nur Kakerlaken und Bajonette stationiert waren. Es schien sich ein Abenteuer anzubahnen. Ich verdanke es meinem Naturell, dass sich mit dieser Aussicht meine Laune erheblich verbesserte.
Unten wartete bereits mein Begleiter auf mich und er ging sogleich wortlos vor mir her. Es ging durch einen kleinen Park in das nächste Gebäude. Ich vermutete, dass es sich dabei um die Hochschule handelte und lag richtig. Als wir es betraten, mussten wir an einer Sicherheitsschranke halten, die von einer mittelalten Frau gewartet wurde, die harsch und schlecht gelaunt wirkte. Nachdem mich mein Begleiter als dazugehörig erklärt hatte, drückte sie missmutig einen Knopf und ließ uns passieren. Wir liefen durch eine große Halle, um dann in einen Gang abzubiegen, der endlos schien. Zunächst reihte sich ein Hörsaal an den anderen, und dann folgten die Büros. Alles war menschenleer und nur selten brannte in den Räumen noch Licht. Nur der Flur war durch eine Art Notbeleuchtung illuminiert, was der ganzen Atmosphäre etwas Tristes gab.
Endlich kamen wir an unserem Ziel an, mein Begleiter öffnete die Tür zu einem kleinen Büro, das mit Akten vollgepackt war und in dem eine kleine Frau saß, die sogleich freudestrahlend aufsprang und auf mich zulief, um mich mit beiden Händen zu ergreifen und in den Arm zu nehmen. Sie sagte mir in gebrochenem Deutsch, dass sie leider keines spräche und strahlte noch mehr. Hinter einem der Aktenberge saß noch ein junger Mann, sodass ich es noch einmal auf Englisch versuchte, und tatsächlich, er war in der Lage, damit zurecht zu kommen. So erfuhr ich, dass es am nächsten Morgen um 9.00 Uhr losginge und sich die Leiterin sehr freue, dass ich da sei. Als diese den Fehler machte, mir noch übersetzen zu lassen, ob mir noch etwas fehle, gab ich zu, dass ich gerne noch etwas essen und mir irgendwo eine Flasche Wasser auf die Nacht kaufen würde, aber bis jetzt keine Gelegenheit gehabt hätte, Geld zu wechseln. Daraufhin ging die Leiterin an ihren Schreibtisch, entnahm diesem ein kleines Plastiketui, dem sie einige Scheine entnahm, die sie meinem Begleiter in die Hand drückte. Dieser werde mit mir gehen, wurde mir bedeutet.
So ging es mit dem armen Teufel, der wohl gedacht hatte, er hätte nach meiner Ablieferung Feierabend, noch in ein kleines Restaurant, wo wir die ukrainische Version von Maultaschen im fetten Sahnebad aßen. Danach ging es noch in einen Supermarkt für eine große Flasche Wasser. Dann trennten wir uns und ich suchte das Hotel auf, und es gelang mir, ohne größere Zwischenfälle einzuschlafen.
Am nächsten Morgen schlenderte ich pünktlich zum Hochschulgebäude und staunte nicht schlecht, wie viele Studentinnen und Studenten bereits unterwegs waren. An der Pforte saß zwar nicht die Frau vom vorigen Abend, aber die jetzt blickte ebenso finster drein. Ich nahm mir vor, sie zu überrumpeln und schnarrte sie in einem militärisch anmutenden Ton mit Kongress! an und hielt meine Seminarunterlagen hoch. Und es funktionierte gleich, ich erntete sogar ein nettes Nicken. In dem riesigen Foyer fiel mir auf, dass die Studenten einfach nicht zueinander passten. Da waren junge Frauen, die aussahen, als gingen sie zu einer Casting Show und gleichzeitig immer wieder Jungs in militärischer Uniform. Später erfuhr ich, dass das Gebäude einerseits die Hochschule für Verwaltung als auch die für Journalismus beherbergte und es zudem Kurse für Mitglieder der Streitkräfte gab, die sich in Administration weiter qualifizieren konnten. Mein Begleiter vom Vortag stand bereits auf der großen Treppe und bedeutete mir, ihm zu folgen. Wieder ging es über lange Flure, die bei Tageslicht freundlicher wirkten, bis wir das Büro einer jüngeren Frau erreichten, die ein exquisites Englisch sprach, Deutsch sehr gut verstand und sich als die Organisatorin des Seminars entpuppte.
Von ihr erfuhr ich, wer an dem Seminar teilnehmen würde und wie die organisatorischen Rahmenbedingungen waren. Sie bedeutete mir, ihr zu folgen und bei einer wieder etwas längeren Reise erzählte sie mir, dass wir uns in der ehemaligen Hochschule der kommunistischen Partei der Ukraine befanden, was die wuchtige Architektur erklärte. Dann betraten wir eine kleine Kantine, die nicht nur einem Offizierskasino glich, sondern, wie sich herausstellte, auch wie ein solches geführt wurde. Dort war bereits gedeckt und Natascha, so hieß die Organisatorin, erklärte mir, dass hier vor dem Seminar noch mit allen gefrühstückt werde. Wir liefen über einen dicken Teppich zu einem Tisch, der etwas exponiert dastand und offensichtlich für die Seminarleitung reserviert war. Dort saß bereits ein Mann, der sogleich aufstand und mich in wohl klingendem Deutsch begrüßte. Er war der Dolmetscher für das Seminar und nannte sich Michail. Was dieser Mann an Sprachkompetenz aufbringen sollte, brachte mich immer wieder in Verblüffung.
Kaum saßen wir, tauchte das Küchenpersonal auf und servierte. Es gab Teller mit geschnittenen Gurken und Tomaten, Rührei und Schinken, Käse, dazu helles, kräftiges und leicht süßes Brot, gesalzene Butter, ein Glas Buttermilch für jeden und Kaffee mit einem leichten Benzinaroma. Während wir uns daran erfreuten, tauchte an unserem Tisch noch die Leiterin der Hochschule auf, genauso liebenswürdig und mütterlich sorgend wie am Vorabend und von der ich jetzt erfuhr, dass sie Swetlana hieß. Und so langsam erschienen auch die Seminarteilnehmer, die alle an unseren Tisch kamen, um uns zu begrüßen, bevor sie sich an ihren reservierten Platz setzten. Es handelte sich vor allem um Bürgermeister, Oberbürgermeister und hohe Funktionäre der Kommunalverwaltung. Da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen sehr wachen, kritischen und pragmatischen Eindruck auf mich machten, stieg meine Freude auf das, was in den nächsten zwei Tagen kommen sollte.
Und es sollte sich lohnen. Kaum war das Seminar eröffnet, hatten wir Diskussionen und eine Unmenge praktischer Beispiele, die so oft so zäh den Teilnehmern zu entlocken sind. In diesen zwei Tagen ging es um Ressourcen und Innovation, um Steuern und Entscheiden. Und in keinem Arbeitsbereich sind diese Fragen so virulent wie in Kommunen. Und, das ist den wenigsten Beobachtern bekannt, nahezu alle Fragen, die eine strategische Bedeutung haben, werden in den Kommunen entschieden. Angesichts dieser Tatsachen stellt sich die Frage, ob die Nationalstaaten überhaupt noch die Relevanz haben, die sie in den internationalen Zusammenschlüssen beanspruchen oder ob es nicht Städtezusammenschlüsse sein müssten, die über relevante Fragen wie Ressourcen, Migration, Ökologie und Partizipation nachdenken und entscheiden sollten. Hier, im Falle der Ukraine, war vieles, was die Städte zum Beispiel in Deutschland bewegt, drastischer und drückender, aber auch dort lief es auf analoge Problemlagen heraus. Das einzige, was uns in der Dimension, die dort alles überlagerte unterschied, war die Korruption. Staatliche Behörden waren davon infiziert und die praktische Kritik der Teilnehmer kam immer wieder an die beiden, sich negativ ergänzenden Punkte: Die Korruption einerseits und die wenig funktionierenden staatlichen Institutionen, die ihrerseits darunter litten, dass zwar neue Gesetze vorlägen, aber weder qualifiziertes noch mit Instrumenten und Macht ausgestattetes Personal in den Behörden existiere, um diese umsetzen zu können. Eine traurige Bilanz, an der sich jedoch arbeiten lässt. Und Erkenntnisse, die bei der polarisierenden Debatte um die Zugehörigkeit zu dem einen oder anderen Weltlager zumindest in Deutschland keinen großen Eindruck hinterließen.
Als der erste Seminartag endete, entschied ich mich, in dem Viertel, in dem die Hochschule stand, noch etwas zu flanieren. Es war für einen Spätsommerabend sehr heiß. Auf den Bürgersteigen, die an den großen Boulevards an die zehn Meter breit waren, standen zahlreiche Kioske, an denen vor allem Kaffee, Bier und belegte Brote verkauft wurden. Die Passanten machten vor allem vom Kaffee regen Gebrauch, setzten sich auf Bänke, unterhielten sich und wirkten entspannt. An der U-Bahnhaltestelle war gleichzeitig eine improvisierter, großer Markt, auf dem alles zu haben war, von der Wilkinsonrasierklinge bis hin zu selbst gezüchteten Tomaten und Gurken und den überaus populären Pelmeni, einer Art slawischer Ravioli oder Maultaschen. Trotz der vielen Menschen, die dort waren, herrschte eine seltsame Ruhe und Ordnung, nirgendwo drängte sich jemand vor oder benahm sich daneben. Das Viertel insgesamt wirkte überaus jung, wahrscheinlich wegen der verschiedenen Hochschulen, die dort ansässig waren.
Nach dem zweiten Seminartag bot mir Michail, der Übersetzer, an, mir das Zentrum von Kiew zu zeigen. Ich war von dem Gedanken begeistert, weil dieser Mann mich nicht nur mit seiner Fähigkeit der Simultanübersetzung tief beeindruckt hatte, sondern weil immer wieder auch profunde historische Kenntnisse in unseren Randgesprächen aufblitzten. Wir fuhren mit der U-Bahn ins Zentrum und landeten gleich am Maidan, der diesmal nicht, wie im Fernsehen, wie eine Festung wirkte, sondern wie jedes andere Stadtzentrum auch. Historisches vermischte sich mit einer Menge Kommerz. Nur die eine oder andere kleine Gedenkstätte erinnerte an die dramatischen Ereignisse, die dort stattgefunden hatten und über deren wahre Zusammenhänge wohl erst die Historiker werden Klarheit schaffen können.
Michail und ich suchten uns zunächst ein Restaurant im Freien, wo wir etwas aßen. Und dann machten wir uns auf den Weg, der mehrere Stunden dauern sollte und mich sehr beeindruckte. Denn ich bekam eine Idee von Kiew und seiner historischen Bedeutung, aber auch von seiner Widersprüchlichkeit. Immer wieder, durch Wasser oder Wald unterbrochen, kamen die einzelnen Kapitel dieser Stadt zum Vorschein, das alte, von Wikingern gegründete Kiew, seine kosakischen Präludien, die russisch-orthodoxe Periode , die stalinistische Monumentalarchitektur bis hin zur marktliberalistischen Aldisierung der Stadtentwicklung. Was mich zunehmend irritierte, war der Gesamteindruck. Ich hatte gedacht, in den Osten zu fahren und vieles sprach zunehmend dafür, im Norden angekommen zu sein. Es fiel auf, dass Kiew, trotz der vielen grausamen Sünden, immer noch eine sehr attraktive, im positiven Sinne urbane Stadt ist, die eine spannende Zukunft haben kann, wenn die richtigen Weichen gestellt werden.
Und wie immer lernte ich Ansichten kennen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Gut, Michail hatte ein überaus positives Verhältnis zu Deutschland und seiner Kultur. Dass er dennoch die historische Rolle der Deutschen nicht zum Anlass nahm, kritisch zu sein, verwunderte mich trotzdem. Und dass er trotz seiner massiven und allumfassenden Kritik an Russland die Auffassung vertrat, Russland solle doch die Krim und den Donbass behalten, Hauptsache die Ukraine bekäme ihren Frieden und die notwendige Ruhe, verblüffte mich dennoch. Ebenfalls, und das lernte ich später, war das Russische als Verkehrssprache längst nicht so verbannt, wie offiziell verlautbart.
Als ich mich von Michail verabschiedete, dunkelte es bereits. Und nachdem ich der U-Bahn in meinem Viertel entstiegen war, entschloss ich mich, irgendwo noch eine Kleinigkeit zu essen und dann meine Sachen zusammenzupacken, weil ich am nächsten Morgen früh aufstehen musste, um zum Flughafen zu kommen. Mir war ein Borimir vorgestellt worden, der mich um acht Uhr abholen und zum Flughafen fahren sollte. Das schien mir etwas knapp, aber Natascha hatte beteuert, an einem Samstagmorgen brauche man höchsten 45 Minuten dorthin.
Ich schlenderte den Boulevard entlang, konnte mich aber nicht so richtig entscheiden, wo oder was ich essen wollte. Im Hinterkopf hatte ich ein kleines Gartenlokal direkt gegenüber dem Hotel, das war die letzte Option. Und tatsächlich reizte mich kein Platz so, dass ich dort angehalten hätte. Also lief ich in den Biergarten, als mich plötzlich ein junger Mann ansprach, der sich als ein Seminarteilnehmer herausstellte. Er hatte den Straßen- mit einem Trainingsanzug getauscht und saß zusammen mit einem Bekannten an einem Tisch. Beide tranken Bier und Schnaps und baten mich, mich zu ihnen zu setzen, was ich auch tat. Und es begann eine Unterhaltung, wie ich sie meinerseits bis dahin noch nie so geführt hatte. Denn sie lief über die Übersetzungsfunktion unserer Handys. Keiner von beiden sprach ein Wort Deutsch oder Englisch.
Es folgte ein langer, langsam vonstatten gehender Dialog über das von ihnen avisierte Abendprogramm. Vergeblich versuchte ich den beiden netten Herren klar zu machen, dass ich eigentlich nicht mehr weg und früh ins Hotel wollte, da ich am kommenden morgen früh aufstehen musste. Immer wieder wurden zwischendurch Freunde angerufen, die Lokale im Zentrum der Stadt vorschlugen. Während der ganzen Diskussion wurde unablässig Bier bestellt und ich hielt mich an ein lokales Tonic, das schmeckte wie Abflussreiniger rochen. Ich blieb hart, was letztendlich dazu führte, dass wir uns darauf einigten, nebenan in ein typisches ukrainisches Lokal zu gehen, um dort etwas gemeinsam zu essen.
Dort angekommen, erschien eine junge Bedienung am Tisch, die von den beiden als Dewotschka angesprochen wurde, was sie lächelnd hinnahm. Der Tisch wurde voll, es erschienen Fischsalate, gesottenes Fleisch, russische Eier, eingelegte Gurken, die mir schon vertrauten Pelmeni und natürlich Sahne. Meine Begleiter bestellten eine Karaffe Wodka und das unsägliche Tonic. Wir prosteten uns ständig zu und nun ging es los mit den berüchtigten Trinksprüchen. Jedesmal warteten wir auf die Übersetzung aus dem Handy, um darauf antworten zu können. Natürlich ging es um Völkerverständigung und Freundschaft, um gemeinsame Perspektiven und die schönen Seiten des Lebens. Zwischendurch bandelten meine Begleiter mit Dewotschkas vom Nebentisch an, was diese freundlich, aber bestimmt abbremsten. Dann ging der Freund von Nikolai, dem Seminarteilnehmer, der mich andauernd fragte, ob er nicht aussähe wie der junge Klitschko, aus dem Lokal, um Geschäftstelefonate zu führen.
Als das Essen zur Neige ging und die dritte Karaffe Wodka geleert war, forderten meine Begleiter die Bedienung auf, dem Gast aus Deutschland doch noch etwas Besonderes zukommen zu lassen. Und kaum gesagt, erschien das hübsche Mädchen lächelnd am Tisch und stellte mir einen Teller mit drei Canapés vor die Nase. Sie bestanden aus dunklem Brot, das ich bereits gekostet hatte und das süßlich schmeckte und einen Hauch von Lebkuchenaroma hatte. Diese waren dick mit Butter beschmiert und darauf lag reichlich Kaviar. Der Biss in diese unerwartete Kombination entpuppte sich als eine Reise in den weiten ukrainischen Himmel. Meine Reaktion war überschwänglich und machte alle glücklich.
Beim Zahlen kam es dann noch zu einer kleinen Verwerfung, weil ich es mir nicht nehmen ließ, meine verbliebenen Valuta noch mit in den Topf zu geben. Nur mein Verweis auf die von mir nicht mehr mögliche Verwendbarkeit versöhnte etwas. Dann bestanden Nikolai und der junge Klitschko darauf, mich noch ins Hotel zu bringen. Wir rauchten noch gemeinsam einen Zigarillo, und dann brachten mich die beiden bis zu meiner Tür, wo ein tränenreicher Abschied stattfand.
Am nächsten Morgen stand ich pünktlich um acht mit meinem Koffer im Foyer, nur Borimir war nicht zu sehen. Ich ging vor die Tür, sah aber niemanden. Ich wartete, was bleib mir anderes übrig. Als um 8.15 Uhr immer noch kein Borimir in Sicht war, wurde ich unruhig. Ich hielt schon einmal Ausschau nach einem Taxi. Und tatsächlich hielt vor dem Tor eines. Der Fahrer stieg aus und schien eine Pause machen zu wollen. Er zündete sich eine Zigarette an und daddelte mit seinem Handy herum. Ich ging auf ihn zu und fragte ihn auf Englisch, ob er mich nach Borispol, dem Flughafen von Kiew, fahren würde. Interessiert sah er mich an und mir war klar, dass er wissen wollte, was dabei herausspringt. Da ich meine ukrainische Valuta bei dem ungeplanten Abschiedsessen gelassen hatte, hielt ich ihm eine Euro-Banknote vor die Nase, die ihn inspirieren sollte, was sie auch tat. Ich sagte ihm, er hätte eine halbe Stunde, was angesichts der anderthalb, die ich auf dem Hinweg gebraucht hatte, verwegen war, aber er nickte. Ich rannte ins Hotel, wo immer noch kein Borimir zu sehen war und los ging es.
Die Fahrt werde ich so schnell nicht vergessen. Es ging in einem Höllentempo über die zunächst vertrauten Boulevards, dann über Schleichwege auf die Autobahn, wieder durch Trabantenstädte und kleine Wälder und als das Taxi mit quietschenden Reifen vor dem Flughafen hielt, waren tatsächlich nur fünfunddreißig Minuten vergangen. Zu meiner Beruhigung reichte es noch, um einzuchecken. Der Rest der Reise verlief nach Plan.
Längst zuhause, sah ich in meinen Mails, dass die Hochschule verzweifelt versucht hatte, mich zu erreichen. Wie sich herausstellte, hatte man dort herausgefunden, dass der gute Borimir mich versetzt hatte, ich war jedoch verschwunden. Folglich hatte sich Madame Swetlana von ihrem Adjutanten zum Flughafen fahren lassen und wohl unter Vorhaltung eines Revolvers oder eines hoch wichtigen Dokumentes erfahren, dass ich eingecheckt hatte. Erst dann war sie beruhigt gewesen und zurückgefahren. Auch ich konnte meine besorgten Partner besänftigen und bedankte mich für die ungemein interessante Exkursion aus der Routine. Dann ging ich zu meinem CD-Schrank, holte das Weiße Album der Beatles heraus und legte Back In The USSR auf. Das war mir immer wieder bei meinen Gängen auf den Boulevards in den Sinn gekommen. Der Himmel weiß, warum.


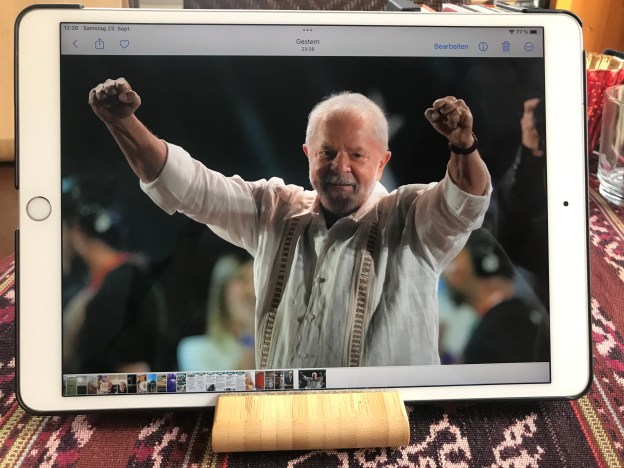
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.